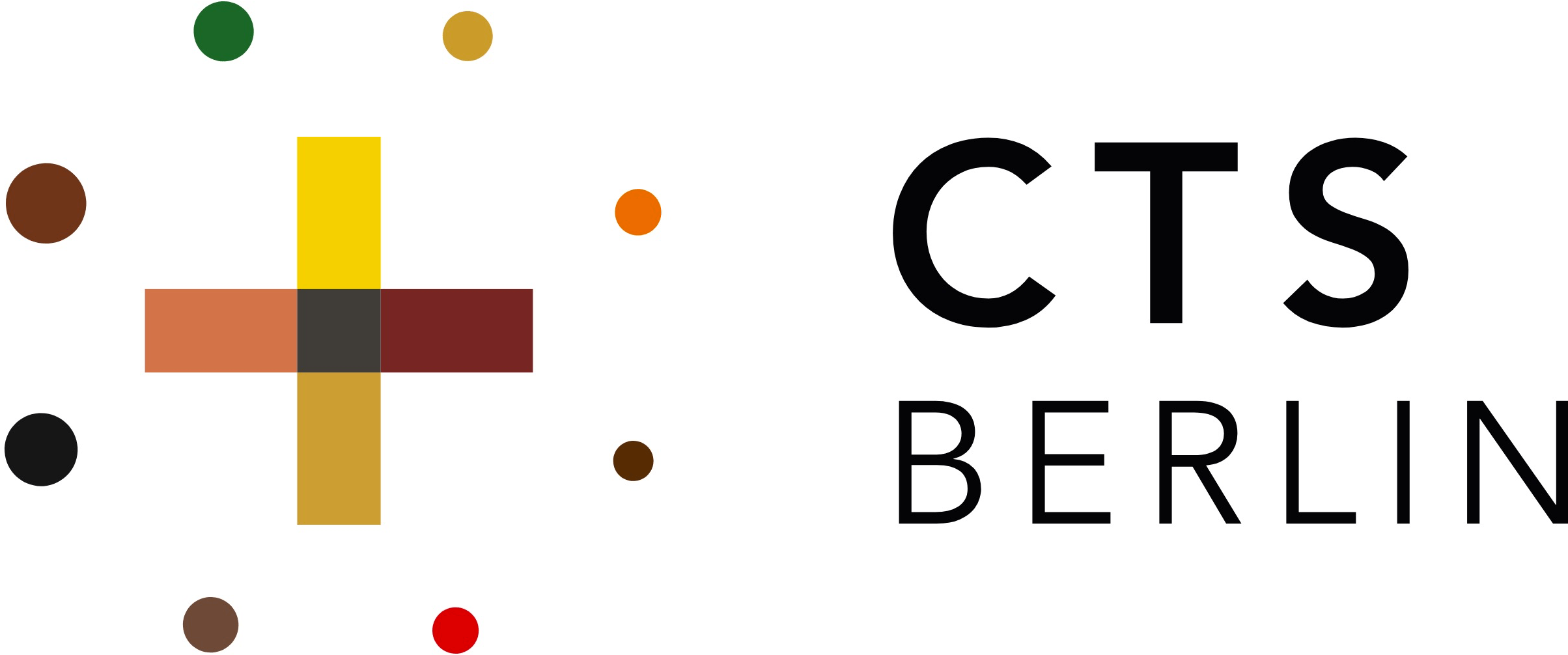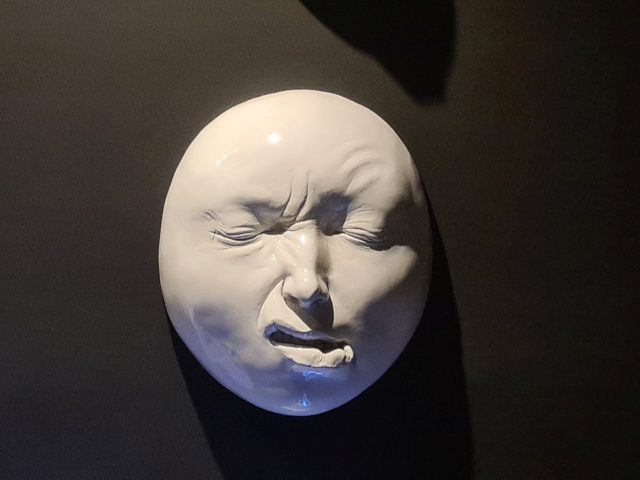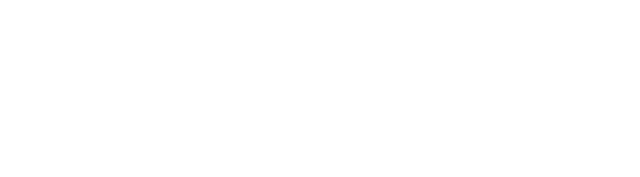Eine jüngere Frau mit geschlossenen Augen, im Lotussitz auf den Stufen eines Treppenhauses hockend, getaucht in regenbogenfarbiges Licht – mit diesem Motiv warb das Berliner Bode-Museum im Sommer 2025 für die Aktion „Das heilende Museum – Achtsamkeit und Meditation im Kunstraum.“
Seit einigen Jahren durchzieht der Achtsamkeitsboom nahezu alle Lebensbereiche. „Das Time Magazine“ sprach schon 2014 von einer „Mindful revolution“. Allein in Deutschland rechnet man mit über 1.000 zertifizierten AchtsamkeitslehrerInnen. Christlich getauft wird in diesem Fahrwasser dann auch Jesus von Nazareth zu einem Meister der Achtsamkeit: Seht euch die Lilien auf dem Feld an … Die Wiederentdeckung von Jesusgebet und Kontemplation mit ihrem „Präsenzmodus“ scheint auf dieser Welle mitzuschwimmen. Auch ein christlicher Theologe spricht in seiner „Einladung zur Achtsamkeit“ von Fallgruben des Geistes (Sorgenstrudel, imaginäre Wunschwelten, Erinnerungsblasen) und ermuntert, sich aufwecken zu lassen, im Hier und Jetzt zu leben.
Einerseits ist diese Entwicklung verständlich und begrüßenswert. Wer wollte ernsthaft bestreiten, dass es ein Gebot der Stunde ist, eine neue Weltbeziehung zu lernen, um mit unseren Schätzen – unserer Umwelt und unserer eigenen Natur – behutsamer umzugehen? Zugleich wird immer spürbarer, dass es eines Ausgleichs bedarf zum beschleunigten und reizintensiven Alltag der Gegenwart. Achtsamkeit wird sozusagen zu einer Überlebenstechnik.
Andererseits lässt es staunen, dass sich eine religiöse Praxis, die aus asiatischen Klöstern stammt, heute als tool in Unternehmen wie SAP, im Gesundheits- und Lebenskunstsektor und in psychologischen Praxen findet – und nun auch in Museen. „Aus einer monastischen Übung wird ein medizinisch und psychologisch evaluiertes-empfohlenes Training“ – so fasst es die Religionswissenschaftlerin Ursula Baatz zusammen. Wie ist es dazu gekommen, dass Achtsamkeitspraktiken aus einem vormodernen, buddhistisch-mönchischen Setting in eine westliche, postsäkulare Gesellschaft transferiert werden konnten und sich dort eingewurzelt haben? Und welche Änderungen hat das Achtsamkeitsdenken dabei durchlaufen (müssen)? Aus der Perspektive der Theologie wird gefragt nach der Vereinbarkeit von Zen-Buddhismus und christlicher Kontemplation.
Neben solcher Suche nach Aufklärung werden inzwischen kritische Anfragen laut. So findet sich etwa der Vorwurf, Achtsamkeitsübungen seien Teil eines „gesellschaftlichen Nützlichkeitskalküls“. Unternehmerisch gelte oft: Lieber Achtsamkeit als bessere Arbeitsbedingungen. Mindfulness – ein Mittel der Effizienzsteigerung in einer neoliberalen Wirtschaft, um das Arbeitstier Mensch auf Dauer profitabel zu halten – und so notwendige politisch-systemische Transformationen zu umgehen? Mitunter gerät die Kritik plakativ und greift zu bissigen Formulierungen („samtpfotige Achtsamkeitsideologen“). Eine literarische, humorvoll karikierende und überzeichnende Auseinandersetzung unternimmt der Romanautor und Jurist Karsten Dusse mit seinen (bisher) fünf „Achtsam morden“-Bestsellern.
Es scheint an der Zeit, das anzugehen, was die Theologie der Spiritualität eine „Unterscheidung der Geister“ nennt. Es gilt, Achtsamkeit so in den Blick zu nehmen, dass man sich gleichermaßen von zwei Extremen fernhält: von Heilsversprechen, die Achtsamkeit wie eine „Quasireligion“ (P. Strasser) anpreisen und zugleich von Polemik, die pauschal rät: „Hör mir auf mit Achtsamkeit!“ (DIE ZEIT 2018). Zugleich bedarf es, wie etwa Jacob Schmidt jüngst herausgearbeitet hat, der Differenzierung, dass es die Achtsamkeit nicht gibt, sondern sich unter dem Dach dieses Begriffs sehr unterschiedliche Strömungen bergen.
Die Ringvorlesung des CTS Berlin in Kooperation mit der Guardini-Stiftung versucht das weite Feld der Achtsamkeit zugleich würdigend und kritisch wahrzunehmen und zu sondieren und es in den Dialog mit der theologisch-spirituellen Tradition des Christentums zu bringen. Folgenden Fragen soll nachgegangen werden:
- Auf welchen Mangel, auf welches Bedürfnis antwortet das „Angebot“ Achtsamkeit? Wie ist die Abhängigkeit vom kulturhistorischen Kontext zu bestimmen?
- Von welchen Überzeugungen, Narrativen und Visionen sind die jeweiligen Strömungen der Achtsamkeit geleitet? Wie steht es z.B. um das Eingehen in ein non-duales Bewusstsein?
- Wo lassen sich Gemeinsamkeiten zwischen den christlichen und buddhistischen Überzeugungen erkennen? Welche Unterschiede sind nicht zu nivellieren?
- Wie steht es um das Verhältnis von „Präsenzmodus“ und „Aktivitätsmodus“, vom Dasein im Hier und Jetzt zur Zukunftsverantwortung der Menschen?
- Inwieweit ist zu unterscheiden zwischen Achtsamkeit als einer Resilienzpraxis zur Stressreduktion, als tool zur Selbstoptimierung, als alternativem Daseinsmodus (Hartmut Rosa) und Achtsamkeit als Spiritualität?
- Inwieweit beachten Achtsamkeitsströmungen neben der Veränderung des Einzelnen auch die Notwendigkeit systemischer Transformationen?
- Wie kommen die „Mystik der geschlossenen Augen“ und die „Mystik der für das Leiden der Welt geöffneten Augen“ in den Achtsamkeitskonzepten zusammen?
- Was bedeutet es für Achtsamkeit, dass sie in der westlichen Rezeption weitgehend ihrer religiösen, ethischen und asketischen Wurzeln beraubt wurde?
Die Ringvorlesung in Kooperation mit der Guardini-Stiftung nimmt ein breites Spektrum von Themen in Blick, die sich unter dem Dach der „Schöpfungsspiritualität“ bergen.

Die Ringvorlesung ist eine Kooperationsveranstaltung mit der Guardini Stiftung.
Die Vorlesungstermine finden jeweils Dienstag um 18:30 Uhr (45 Min. Vortrag + 45 Min Diskussion) in „di galerie“, Askanischer Platz 4, 10963 Berlin, statt.
Termine und Themen:
Erster Block:
28.10.2025
Der Achtsamkeitsboom und seine Hintergründe
Dr. Ursula Baatz, Wien
04.11.2025
Achtsamkeit in zeitgenössischer Esoterik und ihre Wurzeln in Buddhismus und Psychologie
Prof. Dr. Maria Widl, Erfurt
11.11.2025
Zazen als zen-buddhistische Übung der Meditation in Stille
Doko Waskönig. Hannover
13.01.2026
Aufmerksamkeitsbasierte Psychotherapie (MBCT)
Prof. Dr. Johannes Michalak, Witten-Herdecke
20.01.2026
„Sakrament des gegenwärtigen Augenblicks“ – ein spiritueller Klassiker und seine Alltagsmystik
Prof. Dr. Michael Höffner, Münster/Berlin
27.01.2026
Kontemplative Exerzitien und Lebenshaltung nach Franz Jalics SJ
Karin Seethaler, Regensburg
Verantwortlich: Prof. Dr. Michael Höffner
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei.
Aufzeichnungen bisheriger Termine
Aufzeichnungen früherer Ringvorlesungen
© 2024 CTS Berlin | Impressum | Datenschutzerklärung | Institutionelles Schutzkonzept